INSTI Club Köln
Presse
Pressetext
KSTA ERSTELLT 08.07.05, 07:00h
Europaparlament lehnt einheitliche Patente ab
Gegen die Verabschiedung der Richtlinie zur Patentierungsmöglichkeit für Computer-Software gab es vor dem Europäischen Parlament Proteste. Artikel mailen Druckfassung Der Beschluss ist eine Niederlage für die Riesen der Informatikbranche und ein Erfolg für die mittelständische Wirtschaft. Straßburg - Mit der Ablehnung der Richtlinie zur Patentierung von Computerprogrammen hat die EU-Kommission ihr Ziel verfehlt, die voneinander abweichenden Rechtsvorschriften in den EU-Staaten anzugleichen. Die EU-Kommission will nun vorerst keinen neuen Vorstoß dazu unternehmen. Damit bleibt es bis auf weiteres dabei, dass die Computerprogramme ähnlich wie Bücher oder Lieder als geistiges Eigentum behandelt und lediglich urheberrechtlich geschützt sind. Dieser Rechtsschutz ist verhältnismäßig einfach zu erlangen. Anträge auf Patente, die Erfindungen vor dem unberechtigten Kopieren schützen sollen, sind hingegen komplex und mit bis zu 50 000 Euro auch wesentlich teurer. Das Urheberrecht schützt nur den konkreten Programmiercode, nicht aber die Idee oder das Verfahren an sich. In Europa ist es also möglich, dieselbe Idee auf eine andere Weise umzusetzen, ohne gegen das Urheberrecht zu verstoßen. Auch nach der „Erfindung“ der Textverarbeitung Word von Microsoft zum Beispiel dürfen andere Softwarehersteller entsprechende Programme zur Textverarbeitung am Computer entwickeln, ohne Lizenzgebühren zu zahlen. Die Verfechter der aktuellen Fassung der Richtlinie erhoffen sich einen besseren Schutz ihrer technischen Erfindungen im internationalen Wettbewerb. Da in Ländern wie den USA oder in Asien weiter gefasste Patentrechte existieren, befürchten sie die Gefahr eines potenziellen Ausverkaufs der europäischen Innovationskraft. Die Kommission wollte Erfindungen wie computergesteuerte Geräte - etwa Waschmaschinen, Handys oder Auto-Navigationssysteme sowie Antiblockiersysteme - durch einheitliche EU-Patente weitergehend schützen lassen. Klare Abgrenzung vermisst Gegner vermissten allerdings eine klare Abgrenzung zu reiner Software und befürchteten Nachteile für kleine Betriebe oder freie Programmierer, die sich im Gegensatz zu Großkonzernen die teuren Patente und gegebenenfalls Prozesse nicht leisten können. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen hätten dabei unkalkulierbare Rechtsunsicherheiten befürchtet. Ein Programmierer könnte dann nicht mehr davor sicher sein, bei seiner Arbeit möglicherweise ein auch noch so triviales Patent zu verletzen, so die Befürchtungen. Fünf Riesen der Informatik-Branche - Alcatel, Ericsson, Nokia, Philips und Siemens - hatten dagegen vor den „negativen Folgen“ eines Scheiterns der Richtlinie gewarnt. Dies würde in Europa zahlreiche Arbeitsplätze gefährden und Forschung und Entwicklung beeinträchtigen. Die Kritiker warnten vor europäischen Verhältnissen nach amerikanischem Vorbild. In den USA zum Beispiel sind Erfindungen wie der virtuelle Warenkorb beim Einkaufen im Internet, das Herunterladen von MP3-Musikstücken oder das Kaufen von Waren mit einem Mausklick bereits patentiert. Inzwischen gibt es etliche amerikanische Unternehmen wie etwa die frühere Softwarefirma SCO, die nur noch eine starke Anwaltskanzlei unterhalten. Das Geschäftsmodell besteht dabei aus dem Eintreiben von Lizenz- Gebühren für von ihr patentierte oder vermeintlich patentierte Programm-Codes. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Deutschen Bundestag, Matthias Wissmann (CDU), erklärte, allen mittelständischen Unternehmen, die in Deutschland oder anderswo in der EU mit Elektronik in Maschinen, Autos und Mobilfunkgeräten Handel treiben, falle mit der Entscheidung des Europaparlaments über die Ablehnung der Richtlinie „ein Stein vom Herzen“. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) und der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) bedauerten dagegen, dass keine Rechtssicherheit geschaffen worden sei. In allen Streitfragen über Software oder computerimplementierte Erfindungen entscheiden auch künftig die höchsten nationalen Gerichte wie etwa der Bundesgerichtshof in Deutschland. (dpa, afp, rtr)Kölner Wochenspiegel
Nummer 47
Der Club der klugen Tüftler
In der Alten Feuerwache treffen sich einmal im Monat Patent-Entwickler
Nippes - Der INSTI-Club ist eine bundesweite Organisation, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
INSTI steht für "lnnovationsstimulierung" der deutschen Wirtschaft,
seit rund sechs Jahren besteht dieser Club bereits in Köln.
Dahinter verbergen sich kluge Köpfe, die neuartige Ideen auf ihre Machbarkeit abklopfen.
"Im Kern sind wir sieben bis acht Leute, die ein Netzwerk an Hilfsleistungen anbieten",
erläutert der Kölner Clubleiter Joachim Schug.
"Neben mir als Rechercheur stehen zum Beispiel ein Vermarkter und ein Produktdesigner zur Verfügung,
die für die richtige Darstellung eines neuen Produkts sorgen!'
Joachim Schug wurde an der RWTH Aachen zum Ingenieur ausgebildet
und hat jahrelang als Architekt gearbeitet.
Derzeit nimmt er zusammen mit einigen Clumitgliedem
an einem Fernstudium der Uni Hagen bei einem Patentanwalt teil.
"Wir möchten unsere Erfahrungen und Qualifizierungen noch besser an den Mann bringen,"
ist Joachim Schugs Ziel.
Gleichzeitig hofft er, weitere Interessenten,
Sponsoren und Auftraggeber für den INSTI-Club zu finden.
Im ersten Schritt kommen Erfinder und Entwickler zu einem Clubtreffen,
die Erstinformationen benötigen:
"Wie beantrage ich ein Patent oder eine Marke?
Verletze ich mit einer Innovation möglicherweise die Schutzrechte anderer?
Wie entwickle ich am günstigsten Gebrauchs- oder Geschmacksmuster?"
"Man glaubt gar nicht, was es nicht alles schon gibt,"
staunt Joachim Schug immer wieder bei seinen Recherchen.
Die Palette reicht vom Werkzeuggürtel mit neuartigen Clips
über Motorenentwicklungen bis hin zu kombinierten Wind- und Wellenkraftanlagen.
In internationalen Patentämtern spürt er vergleichbaren Entwicklungen nach und überprüft,
ob eine neue Idee mit bereits registrierten,
aber möglicherweise verstaubten Patenten kollidiert.
"Vor allem das US-Patentamt hält zahlreiche Darstellungen in einem etwas altmodischen Stil bereit, die sehr viel Spaß machen", berichtet der Patentrechercheur Schug. "In Deutschland sind die Darstellungen dagegen weitaus nüchterner."
Dabei werden nur etwa drei Prozent aller angemeldeten Patente
tatsächlich zu nutzbaren Endprodukten umgemünzt.
Genau zu diesem entscheidenden Schritt helfen die Mitglieder des Kölner INSTI-Clubs.
Dazu steht ihnen als Pate für rechtliche Angelegenheiten
auch ein Patentanwalt zur Verfügung. (jb)
Das nächste Treffen findet am 22. November in der Alten Feuerwache in Nippes statt.
Eine Anmeldung wird erbeten über das Internet unter www.pa-e.de
Interviewvorlage
an Kölner Wochenspiegel 09.11.04Mit diesem Interview möchten wir nicht nur auf den INSTI Club Köln aufmerksam machen, sondern erhoffen uns auch weitere Interessenten, Sponsoren und Auftraggeber als Anerkennung unserer Fachkenntnisse, Erfahrungen und Angebote.
INSTI Club Köln
'Uns interessiert das neue marktfähige Produkt und seine Absicherung durch Schutzrechte'.
Wir bieten Unternehmen und Laien Lösungen, Beratung, Recherche, Entwicklung für alle gewerblichen Schutzrechte.
Lösungen von Problemen bei Produktion und Produkten.
Beratung für Unternehmen oder Laien, beim Vermarkten ihrer neuen Produkte.
Recherche nach vorhandenen Schutzrechten oder dem Stand der Technik.
Entwicklung notwendiger Schutzrechte und deren Umsetzung.
Für diese Aufgaben stellen sich unsere Mitglieder - Ingenieure, Designer, Handwerker, Laien mit Interesse an technischen Neuerungen und Patentanwälte als Paten - gerne zur Verfügung.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (bmbf) fördert in diesem Sinn deutsche Entwickler beim Erwerb ausländischer Schutzrechte um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu erhöhen.
Aussichten:
'Mit Ideen reich werden'
Dieses Vorurteil lässt sich nur verwirklichen, wenn die Idee zu einem verkäuflichen Produkt umgesetzt wird.
'Patente sind keine Erlaubnis zum Geld drucken'
'Gewerbliche Schutzrechte sind Verbietungsrechte'.
Auch deshalb wird das gewerbliche Schutzrecht in Zukunft durch ein Vergütungsrecht abgelöst werden.
In der Softwareindustrie, wo Schutzrechte bisher kaum zu erlangen waren, werden die Ergebnisse möglichst schnell umgesetzt und damit der Markt rasant bereichert und beschleunigt.
Ähnliches auch in der Wissenschaft ,wo schnelle Veröffentlichung entscheidend ist.
Auch für die Arzneimittelindustrie wird inzwischen gefordert, den Patentschutz durch andere Möglichkeiten zur Vergütung des Entwicklungsaufwands zu ersetzen.
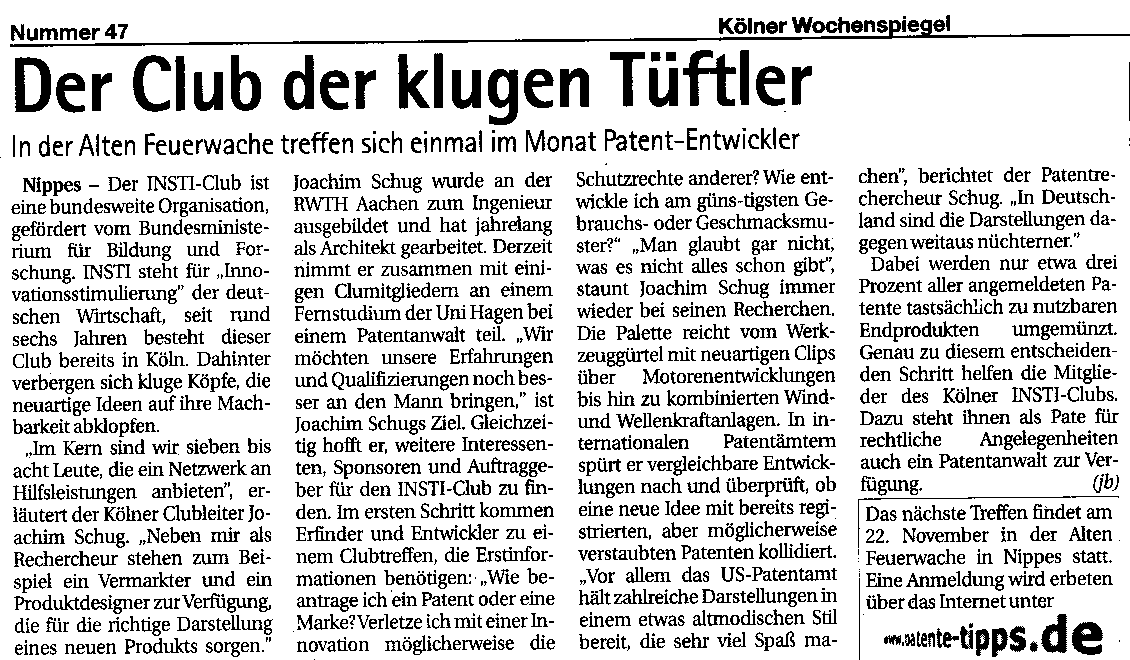
< Startseite < Willkommen
Aktuell> Mitgliederbereich> Presse